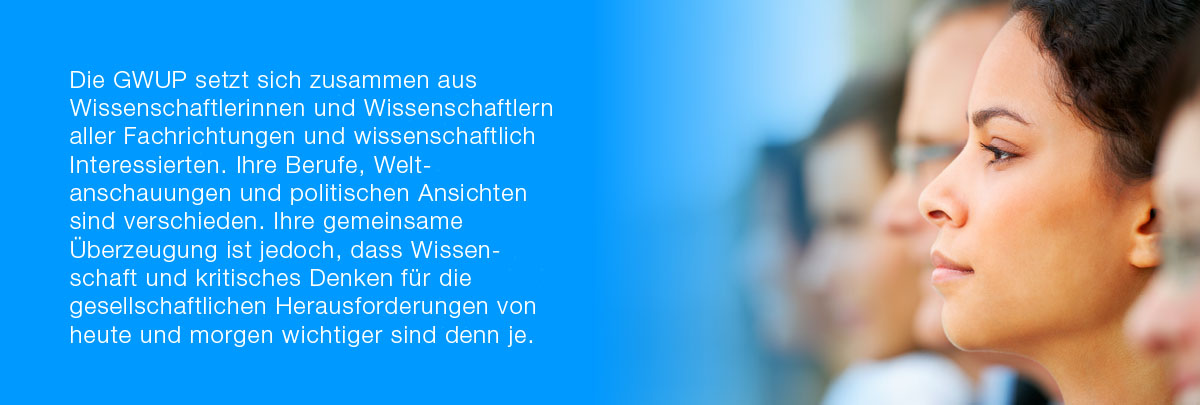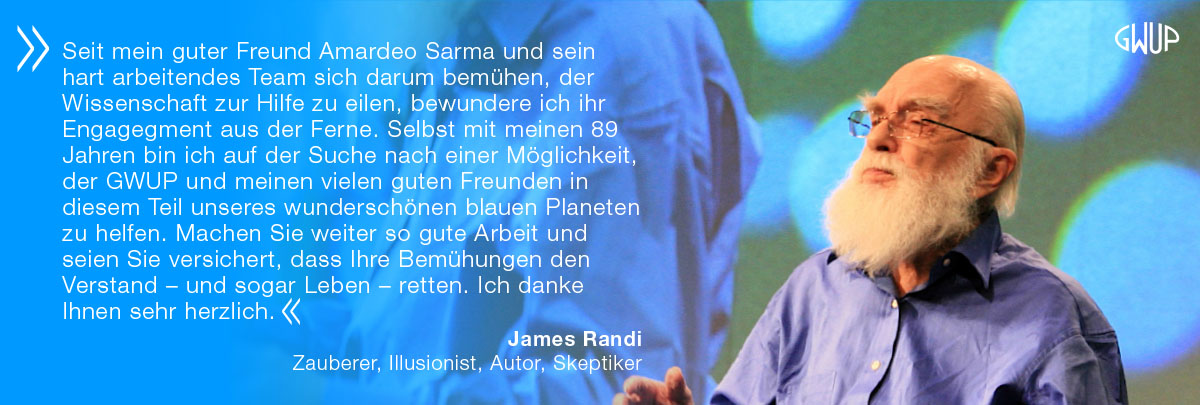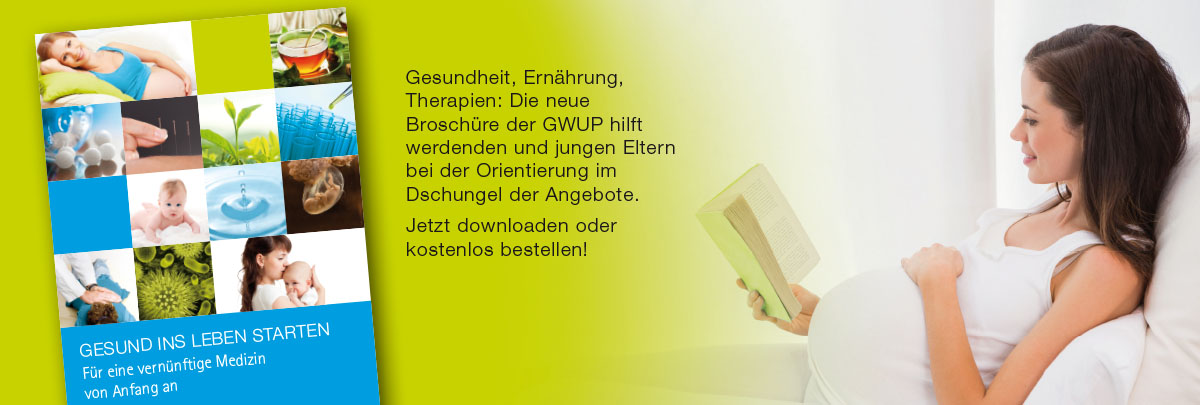Absurde Methoden der Psychodiagnostik
Uwe Kanning
Kann man aus der Schädelform, den Gesichtszügen eines Menschen, seiner Handschrift oder seinem Vor- und Zunamen Informationen über seine Persönlichkeit, seine Talente oder gar seine Bestimmung ablesen? Nein, natürlich nicht. Dennoch versuchen Pseudowissenschaften wie die Psycho-Physiognomik, die Graphologie oder die Namenspsychologie, uns das Gegenteil glauben zu lassen. Dabei lassen sie sich z. T. erstaunlich gut vermarkten. Nicht nur Privatpersonen, auch Firmen nutzen bisweilen die Dienste entsprechender Anbieter beispielsweise zum Zwecke der Personalauswahl. Im Folgenden werden die drei genannten Methoden in ihren Grundzügen vorgestellt. Dabei wird jeweils nach der inhaltlichen Stimmigkeit sowie der empirischen Evidenz gefragt.
Das Interesse an den verborgenen Eigenschaften eines Menschen, seiner wahren Natur oder gar seiner Bestimmung ist so alt wie die Geistesgeschichte der Menschheit. Bis auf den heutigen Tag möchte man sein Gegenüber gern durchschauen und hinter die Fassade aus Freundlichkeit, Selbstdarstellung und gesellschaftlicher Konvention blicken. So verständlich dieses Streben auf der einen Seite auch sein mag, so erschreckend sind doch auf der anderen Seite viele der Methoden, die dem Ratsuchenden heute angeboten und mitunter für viel Geld verkauft werden. Manche bereits totgeglaubten Methoden – wie etwa die Schädeldeutung – sind Jahrhunderte alt, trotzen jeder wissenschaftlichen Evidenz und erleben dennoch eine erstaunliche Renaissance. Andere, wie die Graphologie, scheinen sich nur sehr langsam aufzulösen, während z. B. die Namenspsychologie erst vor wenigen Jahren neu entstanden ist.
Psycho-Physiognomik
Die Psycho-Physiognomik geht davon aus, man könne die Persönlichkeit eines Menschen an dessen Schädelform und Gesichtszügen ablesen. Ihre historischen Wurzeln lassen sich bis auf Aristoteles zurückverfolgen, wobei die tatsächliche Urheberschaft des Altmeisters nicht zweifelsfrei geklärt ist. Aus dem Frühwerk der Schädeldeutung „Physiognomica“ erfährt der geneigte Leser beispielsweise, dass kleine Ohren auf eine kriminelle Neigung hindeuten, während sich ein Feigling dem kundigen Betrachter durch einen weichen Haarwuchs, geduckten Körper und lange dünne Finger offenbart. Besondere Aufmerksamkeit fanden in früheren Zeiten auch Vergleiche zwischen Tier- und Menschengesichtern (Abb. 1), denen zufolge man die vermeintlichen Eigenschaften eines Tieres auf ähnlich aussehende Menschen übertragen kann. Wer einem Schaf oder Kamel ähnelt, sollte mithin eher dümmlich bzw. genügsam sein.

Abb 1: Vergleich zwischen Tier- und Menschengesichtern
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts greift Johann Caspar Lavater (1741–1801) die alte Lehre wieder auf und legt ein vierbändiges Werk vor, das eine Wiedergeburt der Physiognomik begründet. In seiner Folge haben sich viele Gelehrte mit den Thesen der Schädeldeutung auseinandergesetzt und in Befürworter (Goethe) sowie Kritiker (Kant, Hegel) gespalten. Die relative Popularität der Publikationen von Lavater mag nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass er seine Argumente mit umfangreichen Illustrationen versehen hat. So stellt er beispielsweise Bilder von Adeligen und berühmten Persönlichkeiten wie Sir Isaac Newton den Bildern unbekannter Menschen aus dem Volk gegenüber und erklärt anhand der Physiognomie, warum erstere zu besonderen gesellschaftlichen Aufgaben und Leistungen prädestiniert seien (Abb. 2).

Abb. 2: Vergleich zwischen einem Unbekannten und Sir Isaac Newton
Zudem liefert er Skizzen von der typischen Physiognomie unterschiedlichster Intelligenz- und Verbrechertypen. Letzteres wird später zu einem Schwerpunkt der Arbeit des italienischen Psychiaters Cesare Lombroso (1836–1909; vgl. Abb. 3).

Abb. 3: "Gesichter des Verbrechens" nach Lombroso.
Moderne Schädeldeuter berufen sich in aller Regel auf einen Mann, der an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die Bezeichnung „Psycho-Physiognomik“ geprägt hat – den gelernten Porzellan- und Porträtmaler Carl Huter (1861–1912), dessen Lehren durch den in der Schweiz ansässigen Carl-Huter-Bund lebendig gehalten werden. Huter gilt seinen Anhängern bis heute als Universalgenie. Er legte äußerst umfangreiche Deutungskataloge für alle Regionen des menschlichen Schädels vor. So unterscheidet er beispielsweise zehn Nasen- und fünf Kinnformen, denen er jeweils spezifische Persönlichkeitsdeutungen unterlegt, wobei jede Nasenform wiederum in einzelne Deutungsareale zu unterteilen ist. Der Mund bietet fünf solcher Areale, während für die Partie oberhalb eines Auges nicht weniger als sieben vorgesehen sind. Auf der Schädeloberfläche finden sich mehrere dutzend Deutungspunkte. Berücksichtigt man nun noch, dass jedes Areal unterschiedliche Formen aufweisen kann (z. B. mehr oder weniger gewölbt oder groß ist), so bekommt man eine ungefähre Vorstellung von der Komplexität möglicher Interpretationen. Alleine die Betrachtung der Ohren kann zu weit mehr als 3000 Charakterisierungen herangezogen werden (3 Ohrgrößen x 3 Formen der Segelohrigkeit x 3 Ohrzonen x 3 Schrägheitsgrade x 3 Höhenparameter x 5 Ohroberkantenareale x 3 Möglichkeiten des Verhältnisses zwischen rechtem und linkem Ohr). Hinzu kommen Kriterien wie etwa die „Schönheit“ der Ohren. Aber Carl Huter beschäftigt sich nicht nur mit der Schädeldeutung. Für ihn bietet der gesamte Körper eine Grundlage zur Interpretation. Dabei beschränkt er sich jedoch auf die Unterscheidung grundlegender Körpertypen – so genannter „Naturelle“ –, die bereits in der Lehre von den vier Körpersäften nach Galen (129–216) angelegt ist und im 20. Jahrhundert vor allem in der Konstitutionstypologie des deutschen Psychiaters Ernst Kretschmer (1888–1964) weiterlebte. Der Ruf Huters als Universalgenie rührt jedoch nicht nur von seinen Ideen zur Psycho-Physiognomik. Jenseits dieser Arbeit formuliert er Modelle zu unterschiedlichsten Themenfeldern, die ihn und seine Zeit bewegt haben: Graphologie, Irisdiagnostik, Rassenlehre, Paläontologie und schließlich sogar die Entstehung des Weltalls.

Abb. 4: Deutungsareale auf dem Oberkopf (nach Huter 1904, S. 216)
Fragt man nach den Gründen, warum sich überhaupt die Persönlichkeit eines Menschen in der Schädel- und Gesichtsform widerspiegeln soll, so stößt man in der zeitgenössischen Fachliteratur auf weitestgehende Leere. Dies scheint ein Thema zu sein, das heute kaum noch einen Schädeldeuter interessiert. Der erste, der systematisch nach den Ursachen der behaupteten Zusammenhänge gefragt hat, war Franz Joseph Gall (1758–1828), der Begründer der Phrenologie. Er geht davon aus, dass jeder menschlichen Eigenschaft ein spezifisches Hirnareal zugeordnet werden kann. Je stärker eine bestimmte Eigenschaft ausgeprägt ist, desto größer sollte das entsprechende Areal sein. Je nach Größe des Areals wird nun von der Innenseite des Schädels ein mehr oder minder starker Druck auf den Knochen ausgeübt. Dieser Schädelinnendruck wiederum sollte dafür verantwortlich sein, dass an bestimmten Stellen Wölbungen entstehen, die auf eine besonders starke Ausprägung des darunter liegenden Hirnareals hindeuten. Für die damalige Zeit, in der man so gut wie nichts über die Funktion des Gehirns wusste, war dies durchaus eine legitime Hypothese. Aus heutiger Sicht ist sie jedoch völlig unhaltbar. So ist es beispielsweise nicht gelungen, jeder denkbaren Eigenschaft eines Menschen ein spezifisches Hirnareal zuzuordnen und es ist auch unwahrscheinlich, dass dies jemals gelingen wird. Eigenschaften sind wohl eher das Ergebnis eines netzwerkartigen Zusammenspiels unterschiedlicher Hirnstrukturen.
Selbst wenn es klar lokalisierbare Zuschreibungen gäbe, dürfte die Masse der jeweils winzigen Hirnsubstanz nicht stark genug sein, um eine Verformung des Schädels an spezifischen Stellen herbeiführen zu können. Jenseits dieser grundlegenden Einwände hätte man sich zudem auch schon zu Zeiten Galls fragen können, wie denn der vermutete Schädelinnendruck auf die Gestaltung von weiter entfernten Knorpel- und Weichteilen (Nasenform, Ohrläppchengröße etc.) wirken sollte. Dies kann die Theorie Galls nicht erklären.

Ein Schädel, beschriftet nach Franz Joseph Galls Phrenologie-System
Carl Huter beschreitet einen völlig anderen Weg und bleibt dabei deutlich nebulöser als Gall. Nach Huter ist die Körper- und Schädelform das Ergebnis eines Zusammenspiels aus genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen. Hierbei spielen mehrere von ihm eigens definierte „Strahlungsenergien“ eine wichtige Rolle. Die zu deutende Körperhülle ist seiner Theorie zufolge einem ständigen wechselseitigen Energieaustausch zwischen innen und außen ausgesetzt und dieser prägt schließlich das Erscheinungsbild des Menschen. Wie dabei klare Deutungspunkte entstehen sollen, die auf spezifische Eigenschaften des Menschen hindeuten, bleibt unklar.
Zeitgenössische Schädeldeuter äußern sich zu diesem Thema entweder gar nicht (Palm, Pinl 2005), verweisen auf Carl Huter (Castrian 2006) oder sprechen diffus von Energieströmen oder Durchblutungsprozessen, die hier am Werke sein sollen. Alles in allem gibt es bislang also weder eine plausible Theorie der Psycho-Physiognomik noch ein wie auch immer geartetes Bemühen um empirische Evidenz. Nun könnte man zu Recht einwenden, es mag ja auch jenseits einer Theorie Zusammenhänge geben, die man sich bislang noch nicht erklären kann. Nichts wäre leichter, als in einer empirischen Studie beispielsweise den Zusammenhang zwischen der Größe der Ohrläppchen und dem wirtschaftlichen Erfolg der Ohrläppchenträger zu untersuchen. Derartige Studien gibt es leider nicht. Stattdessen beschränken sich moderne Schädeldeuter darauf, den Zusammenhang einfach zu behaupten oder verweisen auf angeblich jahrhundertealtes Erfahrungswissen. Ergänzend hierzu arbeitet man mit konstruierten Vergleichen, die in der Tradition von Lavater und Lombroso stehen. So analysiert z. B. ein zeitgenössischer Psychophysiognom ausführlich den Schädel eines berühmten Rennfahrers und nimmt anschließend eine Interpretation vor, die wohl den meisten Lesern plausibel erscheinen wird: konzentriert, fleißig, willensstark etc. Dass derartige Vergleiche eher den Charakter eines Taschenspielertricks haben, muss hier nicht erläutert werden.
Schauen wir uns zum Schluss noch die diagnostischen Werkzeuge und Prozesse an, die im Rahmen der praktischen Anwendung der Schädeldeutung zum Einsatz kommen. Auch hier muss ein ernüchterndes Fazit gezogen werden. Als „Messinstrument“ fungiert allein das Augenmaß des Schädeldeuters. Ob ein Ohrläppchen als groß, mittelgroß oder klein zu gelten hat, entscheidet er allein, ohne den Einsatz eines Maßbandes oder ähnlicher Hilfsmittel. Inwieweit die sieben Areale oberhalb eines Auges gewölbt oder flach sind, muss er selbst festlegen. Technische Apparaturen oder klare Vergleichsmodelle existieren nicht. Hinzu kommt, dass sich dutzende der Deutungspunkte unter der Kopfbehaarung verbergen und daher gar nicht in die Untersuchung einfließen können. Selbst wenn man dies ausblendet, bleibt immer noch das Problem, wie man die ungeheure Vielzahl der Einzelinformationen, die sich allein aus der Betrachtung von Augen, Nase, Ohren und Mund ergeben, zu einem diagnostischen Urteil integrieren soll. Auch hierzu gibt es keinerlei Regeln. Am schönsten bringt Wilma Castrian – die Grande Dame der deutschen Psycho-Physiognomik – das Niveau der Diagnostik zum Ausdruck, wenn sie schreibt: „Merkmalskataloge sind nur grobe Anhaltspunkte, den Menschen erfahren Sie allein dann, wenn Sie sich selbst leer machen und sich mit allen Sinnen auf ihr Gegenüber einlassen, um zu erkunden: ‚Wer ist dieser Mensch?’ (…) Machen Sie sich dabei bewusst, dass es so etwas wie Telepathie oder Resonanzdimensionen gibt. Es findet eine nonverbale Übermittlung statt, die erstaunliche Botschaften überbringen kann.“ (2006, S. 60).
Alles in allem erweist sich die Psycho-Physiognomik mithin als eine jahrhundertealte Glaubenslehre, die es bis heute nicht einmal geschafft hat, eine plausible, in sich schlüssige Theorie aufzustellen. An die Stelle empirischer Belege treten Behauptungen und Scheinbeweise in Form von Einzelfalldarstellungen. Die Diagnostik spiegelt vor allem das subjektive Empfinden der Diagnostiker wider und kann nicht einmal im Entferntesten übliche Qualitätskriterien erfüllen.
Ungeachtet dieser Fakten befindet sich die Schädeldeutung in Deutschland seit einigen Jahren deutlich im Aufwind. Inzwischen bieten mehrere Unternehmensberatungen ihre fragwürdigen Dienste insbesondere zum Zwecke der Personalauswahl an. Darüber hinaus soll die Physiognomik bei der richtigen Einschätzung von Mitarbeitern und Kunden helfen. In den Medien sind ihre Vertreter gern gesehene Exoten, die nahezu ohne jede Kritik ihre Thesen verbreiten können. Schenkt man den Selbstdarstellungen der Schädeldeuter Glauben, so arbeiten sie inzwischen mit vielen, auch sehr namhaften Unternehmen zusammen. Belegt sind Deutungsseminare für Manager ebenso wie der Einsatz der Psycho-Physiognomik beim TÜV Rheinland (Schwertfeger 2006). Im Jahre 2008 deutete eine Physiognomin auf einer Absolventenmesse in Köln vor großem Publikum die Schädel stellensuchender Studenten, ohne dass irgendjemand hieran öffentlich Anstoß nimmt. Im Frühjahr 2010 bietet die IHK einer deutschen Millionenstadt offiziell Schädeldeutungsseminare für ihre Mitglieder an.
Jenseits der Wirtschaft wird die Psycho-Physiognomik aber auch im privaten Sektor vertrieben. Für einen Beitrag zwischen 270 und 1800 Euro können Eltern beispielsweise vom Carl-Huter-Bund ihre Kinder analysieren lassen, um anschließend die richtigen Entscheidungen zur Förderung der Sprösslinge in die Wege zu leiten. Bei manchen Vertretern der Zunft kann man ein Foto einschicken und sich ein Gutachten zur Selbsterkenntnis erstellen lassen, oder aber man kauft ein Buch zur Selbstanalyse (z. B. Palm, Pinl 2005).
Graphologie
Auch die Graphologie kann auf eine lange Vergangenheit zurückschauen. 1625 legt der italienische Mediziner Camillo Baldi ein erstes Buch vor, in dem er die bis
dahin stattgefundene „Theoriebildung“ zusammenfassend aufarbeitet. Die Bezeichnung Graphologie wird jedoch erst 200 Jahre später durch Jean Hippolyte Michon (1806–1881) eingeführt.
Grundsätzlich nimmt die Graphologie an, man könne aus der Handschrift eines Menschen etwas über dessen individuelle Eigenschaften ablesen. Durch die Handschrift wird ein beschriebenes Blatt Papier gewissermaßen zur Projektionsfläche der Darstellung einer Persönlichkeit. Doch es geht nicht nur um Persönlichkeitsmerkmale, sondern auch um Fähigkeiten, Verhaltensorientierungen und Werte. Helmut Ploog – einer der führenden deutschsprachigen Graphologen – glaubt beispielsweise, er könne in einer Handschrift Informationen über die folgenden Aspekte finden: Lebensziel/Leitbild eines Menschen, Niveau, Format, Struktur, Transparenz, Entwicklungsperspektive, Entwicklungsrückstände, Intelligenz, Vitalität, Temperament, Dynamik, Motivation, Leistungsvermögen, Extraversion/Introversion, Teamverhalten, Kollegialität, emotionelle Resonanz, Korrektheit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Analyse/Synthese, Überblick, Urteilsvermögen, Planung und Organisation, Kreativität, Belastbarkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Ausdrucksfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Überzeugungskraft, Durchsetzungsfähigkeit und Führungsfähigkeit (Ploog 2008).Die Grundlage für entsprechende Deutungen bilden zahlreiche Richtlinien zur Interpretation spezifischer Schriftmerkmale. So interessiert man sich beispiels-weise für die Neigung der Schrift. Eine nach rechts geneigte Schrift spricht demnach für einen Menschen, der sich seiner Umwelt zuneigt, forsch voranschreitet und sogar zügellos sein kann. Menschen mit nach links geneigter Schrift wären hingegen eher zurückhaltend, ängstlich und wenig selbstbewusst. Zudem interessiert sich die Graphologie für die Verbindung zwischen den einzelnen Buchstaben innerhalb eines Wortes. Stehen die Buchstaben isoliert nebeneinander, wird dies als ein untrüglicher Hinweis auf die Sprunghaftigkeit und analytische Kompetenz des Schreibers gedeutet. Demgegenüber erkennt man einen integrativ denkenden Menschen an einem hohen Grad der Verbundenheit der Buchstaben. In diesem Stil werden zahlreiche Schriftmerkmale interpretiert: Regelmäßigkeit, Anfangs- und Endbetonung eines Wortes, Formreichtum, Leserlichkeit, Strichrichtung, Größe, Weite, Strichbreite, Anpressdruck etc. Hinzu kommen Merkmale der Verteilung der Schrift auf einem Blatt: Abstand zwischen den Zeilen, Verlauf der Schriftzeile (z. B. ansteigend oder abfallend), Abstand zwischen dem Text und den Seitenrändern des Blattes. In früheren Jahren hat man überdies gern exemplarische Schriftbeispiele von Personen mit besonderem Lebenslauf zum illustrierenden Vergleich herangezogen (z. B. Generaldirektor vs. Sexualmörder).
Eine schlüssige Begründung dafür, warum überhaupt die Eigenschaften eines Menschen in seiner Handschrift zum Ausdruck kommen sollen, sucht man in der einschlägigen Fachliteratur ebenso vergeblich wie eine differenzierte Theorie zu den spezifischen Deutungen einzelner Schriftmerkmale. Stattdessen begnügen sich manche Graphologen mit dem allgemeinen Hinweis, das Schreiben sei eine besondere Form der Körpersprache und daher ebenso wie diese Ausdruck innerpsychischer Prozesse. Für eine Wissenschaft, die mehrere hundert Jahre Zeit hatte, Theorien zu bilden, ist dies ein trauriges Ergebnis. An die Stelle von Erklärungen treten symbolhafte Assoziationen, wie man sie zum Teil aus der PsychoPhysiognomik kennt: oben = Geist, unten = Trieb (z. B. Buchstaben, die weit nach oben oder unten hinausschießen); links = innen, rechts = außen etc. Jenseits einer fehlenden Erklärung für die angenommenen Zusammenhänge zeichnet sich die Graphologie durch eine diagnostische Praxis aus, die weit davon entfernt ist, internationalen Standards zu genügen. Zwar könnte man die Erfassung ausgewählter Schriftkriterien – wie etwa der Schriftgröße – durch entsprechende Messinstrumente relativ gut objektivieren. Die meisten Kriterien lassen dem Graphologen aber geradezu anarchische Freiheiten. Dies gilt beispielsweise für die Lesbarkeit der Schrift oder auch das Mutmaßen über die Geschwindigkeit, mit der ein Text zu Papier gebracht worden ist. Hierdurch wird das Ergebnis der Diagnose in erheblichem Maße von der Person des Graphologen beeinflusst. Manche Vertreter dieser Zunft sehen hierin sogar eine Stärke ihrer Arbeit und lehnen die Deutung einzelner Schriftmerkmale ab. Stattdessen fahren sie mit einem Stift den Schriftverlauf nach und lassen dabei in sich einen Eindruck von der Persönlichkeit des Verfassers entstehen, den sie dann als das Ergebnis ihrer Untersuchung betrachten. Weitere Probleme ergeben sich aus der völligen Ausblendung möglicher Rahmenbedingungen, die das Schriftbild beeinflussen können. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an das Ausmaß der Routine bei der Abfassung handschriftlicher Texte in einer Zeit, in der die meisten Menschen wohl überwiegend per Computer schreiben. Ebenso dürfte die Auswahl des Papiers und des Schreibgerätes das Schriftbild beeinflussen.
Da die Graphologie bis in die 60er Jahre hinein u. a. in der universitären Psychologie verwurzelt war, überrascht es nicht, dass bislang weit mehr als 200 empirische Studien vorliegen. Unter dem Strich sind die Befunde dieser Studien für die Schriftdeutung allerdings verheerend (King, Koehler 2000). Signifikante Zusammenhänge zwischen graphologischen Gutachten und etablierten Persönlichkeitstests lassen sich nur sehr selten belegen. Wenn dies einmal der Fall ist, fallen sie sehr gering aus und beruhen nicht selten auf methodisch unzureichenden Studien. Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen graphologischer Personalauswahl und dem beruflichen Erfolg lassen sich nur dann belegen, wenn die Graphologen einen Lebenslauf deuten. In diesem Fall ist die Validität der Urteile allerdings ebenso gering wie die einer freien Deutung des Lebenslaufes durch diagnostische Laien. Wird den Schriftdeutern ein handschriftliches Diktat zur Begutachtung vorgelegt, das keinerlei biographische Informationen enthält, sinkt die Validität auf Null (Netter, Ben-Shakhar 1989). Mit anderen Worten, die Kunst der graphologischen Personalauswahl besteht ausschließlich in einer laienhaften Deutung der Inhalte von Lebensläufen. Die eigentliche Deutung der Schrift hat keinen Einfluss auf die Validität des Urteils. Alles in allem betrachtet gehört die Graphologie heute – neben der Astrologie – zu den am besten empirisch widerlegten Pseudowissenschaften.
Die Hochzeit der Graphologie ist in Deutschland sicherlich schon lange vorbei. Dennoch gibt es auch heute noch Unternehmen und Privatpersonen, denen die Dienste eines Graphologen nicht von vornherein suspekt erscheinen (vgl. Schäfer 2009). Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland ca. 2-3 % der Un-ternehmen graphologische Gutachten zur Personalauswahl einsetzen (Schuler et al. 2007). Auf den ersten Blick wirkt diese Zahl nicht besonders beeindruckend. Man muss jedoch bedenken, dass jährlich hunderttausende von Stellen ausgeschrieben werden und sich in aller Regel auf jede Ausschreibung mehrere Menschen bewerben. Im Ergebnis dürften mithin in jedem Jahr mehrere tausend Menschen von der Anwendung der Graphologie in der Personalauswahl betroffen sein. Das zentrale Verkaufsargument ist dabei übrigens die angeblich unmögliche Verfälschbarkeit er Handschrift.

Top-Abschluss, beste Referenzen. ob es jedoch mit dem Traumlob klappt, dafür ist manchen Unternehmen die Handschrift mitentscheidend.
Quelle: Gina Sanders - Fotolia.com
Ähnlich wie bei der Psycho-Physiognomik wird die Graphologie aber auch zu privaten Zwecken eingesetzt. Ein Zitat von Helmut Ploog spricht hier für sich: „...wenn ein Vater die Verbindung seiner Tochter mit einem Haftentlassenen beurteilen lassen will oder wenn die Mutter eines jungen Arztes dessen Heirat mit einer Krankenschwester vereiteln oder wenn ein junger Deutscher eine Frau von den Philippinen heiraten möchte. In all diesen Fällen ist es unbedingt erforderlich, die Schriften beider Partner zu sehen, um die Reagenz der zwei Personen aufeinander abzuschätzen.“ (Ploog 2008, S. 146f). Andere Einsatzgebiete wären wiederum die Begabungsanalyse bei Kindern und Jugendlichen sowie ihre Verwendung als diagnostisches Mittel in der Psychotherapie. Wer mehr über sich selbst erfahren möchte, kann zudem im Internet seine eigene Handschrift mit mehreren Beurteilungsskalen einschätzen und erhält anschließend ein aus Textbausteinen zusammengesetztes Gutachten
Namenspsychologie
Während die Psycho-Physiognomik und die Graphologie auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblicken können, handelt es sich bei der Namenspsychologie um einen Ansatz, der erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist. Dabei verdeutlicht die Namenspsychologie in hervorragender Weise, wie man auch in unseren Tagen allein durch die Aneinanderreihung völlig beliebiger Behauptungen eine pseudodiagnostische Methode aus der Taufe hebt. Die Erfahrungen mit der Psycho-Physiognomik oder auch der Astrologie lassen befürchten, dass man sie auch noch in hundert Jahren betreiben wird.
Der Grundgedanke ist sehr einfach: Aus der Abfolge der Buchstaben im Vor- und Zunamen eines Menschen will die Begründerin der Namenspsychologie – Angelika Hoefler – so mancherlei Verborgenes über einen Menschen ablesen können: „woraus der Mensch seine Kraft bezieht, wie diese Kraft beschaffen ist, welche Haupteigenschaft ein Mensch aus vergangenen Leben mitbringt, welches Ziel er hat, welche Aufgaben er in seinem Leben erfüllen muss, welchen Weg er gehen kann, welche Eigenschaften er hat, welchen Ruf er genießt, die gesamte materielle Seite des Lebens, wie sich Partner-schaften entwickeln, seine Zufriedenheit“ u. v. m. (Hoefler 2000).
Die zum Zwecke der Deutung eingesetzte Methode ist recht komplex. Zunächst einmal hat jeder Buchstabe für sich eine Bedeutung bzw. „Energie“ (Beispiel: B = Wissen, Intellekt, Studien, Theorie, Bewusstseinsentwicklung; Hoefler 2004). Zudem besitzt jeder Platz, an dem sich ein Buchstabe im Namen befinden kann, eine eigene Energieform. Der erste Buchstabe eines Namens steht im ersten „Haus“, das wiederum für „Wille, Energie, Kraft, Disziplin, Konzentration, Durchsetzungsvermögen und Autorität“ steht. Beginnt der Vorname mit dem Buchstaben B, sind beide soeben skizzierten Energieformen in der fraglichen Person miteinander verwoben. Dementsprechend wird Buchstabe für Buchstabe jede Energiekombination gedeutet. Doch damit nicht genug. Das „Lebensthema“ eines Menschen kann man an der bloßen Summe der Buchstaben ablesen. Der „Charakterkern“ ergibt sich hingegen aus der Quersumme der „Platzenergien“ der mittleren Buchstaben eines Namens. Weitere Quersummen der Platzenergien werden für die Buchstaben links und rechts des Charakterkerns berechnet. Sie geben Aufschluss über das Handlungspotential eines Menschen (links) sowie sein Denkpotential (rechts). Zudem berechnet man die so genannten Charakterschalen“ ebenfalls über Quersummen. Die äußere Charakterschale wird aus dem ersten und dem letzten Buchstaben gebildet. Wem dies noch nicht reicht, der kann auch alle Buchstaben deuten, die nicht (!) in dem Namen vorkommen. Wir wollen es mit dieser recht oberflächlichen Skizze der Auswertungsmöglichkeiten einmal bewenden lassen. Fragen wir lieber nach den Wurzeln dieser geheimnisvollen Lehre.
Frau Hoefler beschreibt selbst ihr Vorgehen bei der Entwicklung der Namenspsychologie am besten: „Ich habe viele hunderte auch historischer Namen untersucht, unzählige Erkenntnismethoden erprobt und wieder verworfen, neue erprobt und wieder neue und wieder andere.“ (Hoefler 2004, S. 8). Das war’s, mehr wird dem interessierten Leser nicht verraten. Würde nun ein Kritiker einwenden, der Name eines Menschen könne überhaupt nichts mit seiner Persönlichkeit, seinem Schicksal etc. zu tun haben, da die Eltern den Vornamen frei wählen und der Familienname beispielsweise durch eine Heirat verändert werden kann, hätte Frau Hoefler eine für sie offenbar überzeugende Kette von Gegenargumenten: Sie glaubt an die Wiedergeburt. Verlässt eine Seele einen toten Körper, sucht sie sich ein neugeborenes Kind, in das sie schlüpfen kann. Bei der Suche nach dem passenden Leib muss die geistige Welt darauf achten, dass der Familienname namenspsychologisch zu den Eigenschaften der Seele passt. Der Vorname wird dann nur noch scheinbar frei gewählt. In Wirklichkeit ist es so, dass die geistige Welt den Eltern den Namen eingibt und zwar so, dass sie genau den Namen für ihr Kind auswählen, der namenspsychologisch zur einfahrenden Seele passt. Ähnlich verhält es sich bei Namensänderungen. Auch sie sind vorherbestimmt. Unbewusst wählt man seinen Lebenspartner so aus, dass auch der neue Familienname dem Wesen der Seele entspricht. Aber leider kann die geistige Welt nicht alles kontrollieren. Schwierigkeiten entstehen beispielsweise, wenn man von seiner Umwelt einen Spitznamen übergestülpt bekommt, der nicht zur eigenen Seele passt. Dies – so weiß Frau Hoefler zu berichten – kann dann der Beginn einer psychischen Störung sein.Empirische Studien zur Namenspsychologie gibt es nicht. Wahrscheinlich hätte die Gründerin ein derartiges Ansinnen auch als allzu weltliche, ja geradezu naive Sichtweise auf die geheimnisvollen Wahrheiten der geistigen Welt abgelehnt. Wissenschaftler haben sich der Sache bislang wohl nicht angenommen, da die Namenspsychologie zum einen eine sehr kleine, fast unbekannte Pseudowissenschaft ist und zum anderen durch ihre quasireligiösen Wurzeln nicht satisfaktionsfähig erscheint. Gleichwohl wurde auch die Namenspsychologie wirtschaftlich genutzt. Natürlich bietet sich hier ebenso wie bei der Psycho-Physiognomik und der Graphologie das Einsatzgebiet der Personalauswahl an. Zudem kann man sich selbst privat analysieren lassen. Dabei scheint die Namenspsychologie gegenüber ihren Konkurrenten einen deutlichen Marktvorteil zu haben, da man sie besonders leicht ohne jedes Wissen über die zu deutende Person vornehmen kann. Alles, was man dazu benötigt, ist allein der Vor- und Zuname eines Menschen. Frau Hoefler gibt im Jahre 2004 an, bis dahin mehr als 15 000 Namensanalysen durchgeführt zu haben.

Name als Schicksal: Anhänger der Namenspsychologie sind davon überzeugt, dass höhere Mächte die Abfolge der Buchstaben in unseren Namen vorherbestimmen - und damit unsere Geschicke lenken.
Quelle: Tomy - Fotolia.com
Vor dem Hintergrund der Hoefler’schen Theorie mutet allerdings ein anderes Marktsegment etwas merkwürdig an. Die Namenspsychologie soll Unternehmen auch bei der Namensfindung für Produkte oder bei Fragen der Fusion behilflich sein. So wusste Frau Hoefler nach eigenem Bekunden schon lange vor dem Scheitern der Fusion von Time Warner und AOL, dass dieser Zusammenschluss nicht gut gehen konnte, denn schließlich passen beide Firmennamen nicht zueinander. Dies kann man natürlich nur nach einer namenspsychologischen Analyse erkennen. Leider nimmt Frau Hoefler nicht Stellung dazu, wie man sich Derartiges erklären kann. Können Seelen auf der Suche nach einer neuen Heimat auch in Firmen oder Produkte einfahren? Wir wissen es nicht.
Die Psychologie der Scharlatanerie
Weder Psycho-Physiognomik noch Graphologie oder Namenspsychologie liefern ihren Kunden eine diagnostisch wertvolle Aussage über verborgene Merkmale eines Menschen. Orientiert man sich allein an den Fakten, so müsste jede dieser Methoden inzwischen vom Markt verschwunden sein. Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Dutzendfach empirisch widerlegte Ansätze wie die Graphologie finden immer noch zahlreiche Anhänger und Kunden. Wie lässt sich dergleichen vor dem Hintergrund bekannter psychologischer Phänomene erklären?
Zunächst einmal scheint es so, als würden die Anbieter offenbar ein wichtiges Bedürfnis ihrer Kunden befriedigen. Nicht nur im Rahmen der Personalauswahl möchte man ganz gern einmal hinter die Fassade der Selbstdarstellung eines Menschen blicken und zu seinem wahren Kern vorstoßen. Die Anbieter behaupten ganz einfach, dass ihre Methode hierzu in der Lage sei und noch dazu mit wenig Aufwand und vertretbaren Kosten einhergehe.

Hinter die Maske der Mitmenschen schauen - wer möchte das nicht manchmal?
Quelle: Denise Campione - Fotolia.com
Trotz dieser Versprechungen dürften die meisten potenziellen Kunden skeptisch bleiben. Im Grunde genommen befinden sie sich in einem Zustand der Unsicherheit. Sie wissen nicht, welche Entscheidung (Angebot annehmen oder ablehnen) die richtige wäre. Die in der Psychologie empirisch gut abgesicherte Theorie der sozialen Vergleichsprozesse (Festinger 1954) besagt, dass man in einem solchen Zustand im Prinzip auf zwei alternative Informationsquellen zurückgreifen kann: Entweder sucht man objektive Fakten oder aber – wenn solche Fakten nicht verfügbar sind – man schaut, welche Meinung andere Menschen zu diesem Thema haben (= sozialer Vergleich). Richtig erscheint dann das, was viele andere Menschen glauben. Die Forschung zeigt, dass wir selbst dann zu einem solchen Vergleich neigen, wenn prinzipiell objektive Informationen zur Verfügung stehen würden. Diese Prinzipien machen sich die Vertreter unseriöser Diagnosemethodenzunutze, wenn sie auf viele, z. T. auch prominente Kunden (Personen oder Firmen) verweisen, die ihre Dienstleistungen bislang in Anspruch genommen haben. Zudem deutet das immer wieder gern eingesetzte Argument, es handele sich um eine Wissenschaft mit jahrhundertealter Tradition, auf tausende von Menschen hin, die diesem Weg gefolgt sind. Im Kurzschluss verfahren manche potenziellen Kunden dann nach dem Urteilsprinzip „Millionen Leser können sich nicht irren.“
Hilfreich erweist sich überdies eine gewisse Präsenz der Pseudowissenschaft in der Mediengesellschaft. Dabei wirkt sich der HäufigkeitsValiditäts-Effekt (Hertwig 1993) zu Gunsten der Anbieter aus. Der Effekt besteht darin, dass Menschen eine Aussage umso glaubwürdiger erscheint, je häufiger sie mit ihr konfrontiert werden. Vorteilhaft ist es zudem, wenn die einzelnen Informationsquellen unabhängig voneinander erscheinen. Am Beispiel der Psycho-Physiognomik kann man den Effekt gut verdeutlichen: Irgendwann einmal liest ein Bürger in einer Illustrierten einen völlig unkritischen Beitrag über die Möglichkeiten der Schädeldeutung. Wenige Wochen später sieht er einen hierzu passenden Bericht in einem TV-Magazin. Hierdurch neugierig geworden geht er ins Internet und findet zum Stichwort „Physiognomik“ tausende von Einträgen. Auch wenn es hierunter durchaus kritische Einträge gibt, überwiegen doch die neutralen oder gar positiven Darstellungen. Zu guter Letzt erfährt die Person vielleicht noch, dass die örtliche IHK entsprechende Schulungen anbietet oder die Personalabteilung des eigenen Arbeitgebers einen Schädeldeuter zum Vortrag eingeladen hat.
Die Anbieter diagnostischer Dienstleistungen bleiben jedoch nicht nur passiv und warten ab, dass über sie berichtet wird, sie liefern ihrerseits reichhaltige Scheinbeweise für die Qualität ihrer Aussagen. Besonders beliebt sind Analysen von prominenten Personen, bei denen das Gutachten die Person weitestgehend so schildert, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Leitet man beispielsweise aus der Handschrift von Barack Obama Hinweise auf eine hohe Durchsetzungsstärke ab, so werden viele Betrachter zustimmend nicken und hierin einen Beleg für die Qualität der Graphologie sehen. Einen noch absurderen Weg beschreibt Angelika Hoefler, wenn sie ihren eigenen Namen nach allen Regeln der Kunst deutet und zu dem Ergebnis kommt, dass er „Wahrheit“ bedeutet. Dies wiederum erscheint ihr als ein untrüglicher Hinweis darauf, dass die von ihr entwickelte Namenspsychologie wahr sein muss. Vielen Menschen mag dieser abenteuerliche Zirkelschluss als solcher gar nicht auffallen.
Eine besondere Form des Scheinbeweises liegt vor, wenn die begutachteten Personen sich selbst in ihrem Gutachten wiedererkennen und dies wiederum als einen besonders überzeugenden Beleg für die Qualität der Methode interpretieren. Schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat jedoch der amerikanische Psychologe Forer empirisch gezeigt, dass dies ein Kurzschluss ist. In seiner wegweisenden Untersuchung legt er mehreren Studenten dasselbe Persönlichkeitsgutachten vor. In dem Glauben, es sei ganz individuell für sie verfasst worden, finden sich die Probanden trotz unterschiedlicher Persönlichkeit im Durchschnitt sehr gut beschrieben. Der Trick besteht darin, dass man möglichst allgemeine und zum Teil auch einander widersprechende Aussagen formuliert. Sie bieten nahezu jedem Leser die Möglichkeit, sich irgendwie in dem Gutachten wiederzufinden (= Forer-Effekt oder Barnum-Effekt). Droht eine ernstzunehmende empirische Überprüfung der eigenen Thesen, so kann man als Vertreter einer Pseudowissenschaft jederzeit eine ablehnende, erkenntnistheoretische Perspektive einnehmen. Man definiert sich kurzerhand als Vertreter einer geisteswissenschaftlich-konstruktivistischen Strömung, deren Inhalte man mit Methoden, die an naturwissenschaftliches Arbeiten angelehnt sind, schlichtweg nicht untersuchen kann. Auf diesem Wege immunisiert man sich gegen jegliche Kritik von Seiten der empirischen Wissenschaft.
Die Analyse möglicher Gründe für das Überleben bzw. die Wiederauferstehung pseudowissenschaftlicher Methoden ist an dieser Stelle sicherlich noch unvollständig. Letztlich ist es ein Konglomerat vieler Faktoren, die zusammenwirken. Trotz aller Bemühungen um Erklärungen bleibt man dabei als Betrachter jedoch nicht selten mit einer gewissen Fassungslosigkeit zurück. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man prominenten Vertretern der Pseudowissenschaft persönlich begegnet. Mit Argumenten kommt man hier nicht weiter. Das Unterfangen verspricht ungefähr so viel Erfolg wie der Versuch, vom Papst einen empirischen Gottesbeweis einzufordern. Die überzeugten Anhänger wird man nicht mehr zur Vernunft bekehren können. Daher muss die Zielrichtung einer um Aufklärung bemühten Wissenschaft vor allem darin bestehen, die noch nicht infizierten potenziellen Kunden in ihrer vielleicht nur latent vorhandenen Skepsis zu bestärken.
Literatur
Castrian, W. (2006): Praxis der Psycho-Physiognomik. Haug, Stuttgart.
Festinger, L. (1954): A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117–140.
Forer, B. R. (1949): The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal Social Psychology, 44, 118–123.
Hertwig, R. (1993): Frequency-validity-effect und hindsight-bias: Unterschiedliche Phänomene – gleiche Prozesse?. In: Hell; W.; Fiedler, K.; Gigerenzer, G. (Hrsg.): Kognitive Täuschungen. Spektrum, Heidelberg.
Hoefler, A. (2004): Die Psychologie des Namens. Wildpferd, Bonn.
Kanning, U. P. (2007): Wie Sie garantiert nicht erfolgreich werden! Dem Phänomen der Erfolgsgurus auf der Spur. Pabst, Lengerich.
Kanning, U. P. (2010): Von Schädeldeutern und anderen Scharlatanen. Unseriöse Methoden der Psychodiagnostik. Pabst, Lengerich.
King, R. N.; Koehler, D. J. (2000): Illusory correlations in graphological inference. Journal of Experimental Psychology, 6, 336–348.
Netter, E.; Ben-Shakhar, G. (1989): The predictive validity of graphological inferences: A meta-analytic approach. Personality and Individual Differences, 10, 737–745.
Palm, S.; Pinl, A. (2005): Face-Reading. Was das Gesicht über die Persönlichkeit verrät. Kösel, Fulda.
Ploog, H. (2008): Handschriften deuten. Humboldt, Hannover.
Schäfer, R. (2009): Die Graphologie in der Personalauswahl: Eine kritische Analyse. Skeptiker, 1/2009, 36–39.
Schuler, H.; Hell, B.; Trapmann, S.; Schaar, H.; Boramir, I. (2007): Die Nutzung psychologischer Verfahren der externen Personalauswahl in deutschen Unternehmen – Ein Vergleich über 20 Jahre. Zeitschrift für Personalpsychologie, 6, 60–70.
Schwertfeger, B. (2006): Personalauswahl per Gesichtsanalyse. Personalmagazin, 11/2006, 32–35.
Prof. Dr. Uwe Peter Kanning, Jahrgang 1966, Dipl.-Psych., Professor für Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Osnabrück. Autor von mehr als einem Dutzend Fachbüchern, darunter „Von Schädeldeutern und anderen Scharlatanen. Unseriöse Methoden der Psychodiagnostik“ 2010.
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!